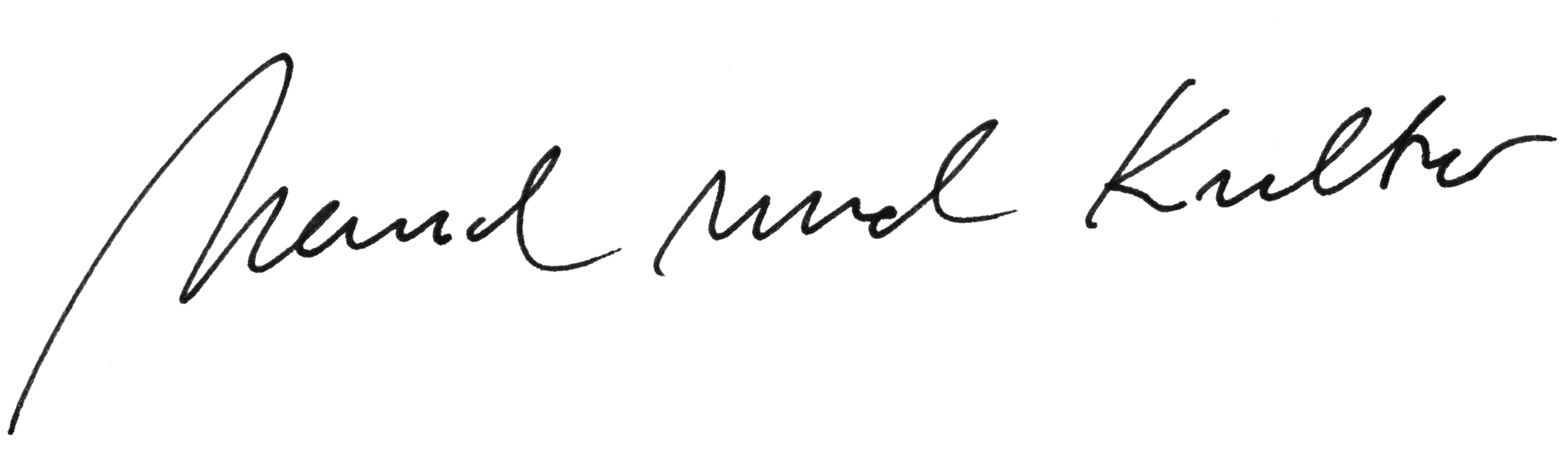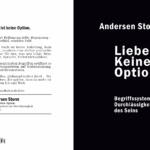0. Kultur-Window-Shopping – Ein Abendspaziergang
Ich habe mir – aus aktuellem Anlass (Spoiler: eigene Buchveröffentlichungen) – gestern Abend bei einem Spaziergang durch Leipzig die Auslagen einiger legendärer Buchhandlungen angesehen. (Meine Themen: Selfpublishing–Sichtbarkeit–Buchmarkt.)
Was mich dabei besonders irritierte:
Einkochtipps und Haushaltsratgeber im Retro-Stil – ornamentierte Pappbände mit Deckelschild, liebevoll gestaltet, schmal, hochpreisig.
Anmutung bibliophiler Lyrik – Inhalt: Ratgebersimulation.
Die Zielgruppe? Offenbar Menschen ohne Internetzugang, oder mit Konsumbereitschaft für symbolische Lebensführung.
Wenig Tipps – viel Gefühl – hoher Preis – Achselzucken.
Mein Eindruck: Zwischen Bestseller-Stapel, Wohlfühlcover und erwartbarer Thementreue schien sich eine stille Botschaft durchzuziehen:
Das Buch ist da – aber vor allem dort, wo es nicht stört.
1. Kultur als Ware der Entlastung (und Medien-Entschleunigung)
Das Buch hat sich – in weiten Teilen des Marktes – von seiner Funktion als Herausforderung, Weltdeutung oder Störung verabschiedet.
An seine Stelle tritt zunehmend ein Format, das emotionalen Service bietet: Trost, Ordnung, Sinn, Zugehörigkeit.
Bücher sollen heute weniger irritieren als beruhigen.
Weniger aufreißen als heilen.
Weniger Neues denken lassen als Bekanntes bestätigen.
Gleichzeitig existiert eine zweite Nachfragegruppe:
Menschen mit Bildungshintergrund und Medienbewusstsein, die Bücher als kontrollierte Alternative zur Überreiztheit anderer Medien wählen – als entschleunigte, geistig gepflegte Unterhaltung.
Für sie ist das Buch kein Ort der Zumutung, sondern ein Rückzugsort für reflektierten Kulturkonsum – angenehm komplex, aber nicht verstörend.
Beide Gruppen – die erschöpfte und die auswählende – stärken gemeinsam jene Sortimentslogik, die „fordernde, aber anschlussfähige“ Inhalte bevorzugt und konsequente Irritation meidet.
2. Wohlfühlkultur im Distributionskanal
In digitalen wie analogen Buchhandlungen herrscht eine sichtbar gewordene Filterung:
Nur was sich als anschlussfähig und belastungsarm präsentiert, passiert die Schwelle der Sichtbarkeit.
Der Kanal – ob Plattformalgorithmus, Buchhandelsfläche oder Empfehlungslogik – funktioniert nicht neutral.
Er strukturiert den Zugang zur Kultur nach dem Prinzip:
„Was nicht leicht konsumierbar ist, wird nicht gezeigt.“
Dabei ist das Wirkliche – das Weltbeschreibende – nicht völlig verschwunden. Es wird kanalisiert.
In der Kriminalliteratur darf das Böse auftreten – ebenso wie das wirkliche Leben. Doch beides erscheint durch die Brille der Kriminalitätsbekämpfung: als benennbare Störung im sozialen Gefüge, die sich aufklären, verfolgen oder zumindest als moralisches Problem rahmen lässt. Mit Gänsehaut ob leichtem Grusel.
In Fantasy-Welten wird das Wirkliche ästhetisiert oder romantisiert – das Grauen erscheint als Teil eines großen Gleichgewichts oder als Herausforderung für die Auserwählten. Wird es gemeistert werden?
Spannend? Ja – wenn es gut gemacht ist.
Offener Ausgang? Niemals!
(Ausnahmen bestätugen die Regel. Prediktabel.)
Das Reale wird so entweder in fiktionale Ordnung überführt oder in Traumwelten verschoben, wo es nicht mehr als Zumutung wirkt, sondern als Erzählstruktur.
Dies erzeugt eine systematische Vermeidung echter Konfrontation mit Ambivalenz, Gewalt, Abgründigkeit – als ästhetisch vermitteltes Bedürfnis nach Sicherheit.
3. Folgen für die Öffentlichkeit
Wenn Kultur nur noch im Wohlfühlformat vermittelt wird, verlagert sich Öffentlichkeit in ein ästhetisch beruhigtes Selbstgespräch.
Diskurs wird Simulation.
Kultur wird Wellness.
Das Lesbare wird zum Spiegel des Erträglichen.
Die gesellschaftliche Funktion des Buches – als Ort der Infragestellung, als Träger diskontinuierlicher Erfahrung – wird dabei nicht ersetzt, sondern ausgeblendet.
Das bedeutet nicht, dass diese Bücher nicht existieren.
Sie existieren außerhalb des Kanals.
4. Gegenstrategie: Präsenz außerhalb des Systems
Wer Kultur nicht als Kanalware begreift, sondern als Praxis, muss sich außerhalb der Distributionslogik sichtbar machen.
Oder ebenda suchen.
Nicht trotz der Vermeidung, sondern jenseits davon.
Kultur als Intervention.
Buch als Denkstoff.
Öffentlichkeit als Zumutung – im besten Sinne.
Und schön, dass es Selfpublishing gibt:
Jetzt kann endlich an alles gedacht, über alles geschrieben, jede Perspektive formuliert werden –
nur eben außerhalb der Sichtbarkeit.
„Wir Verlage können uns inzwischen beruhigt ‚wichtigerem‚ widmen: marktfähiger Stoff, vertraute Formen, wachstumsstarke Segmente.
Denn Geld verdient man mit Literatur eben bei Verlagen. Nicht ausschließlich, aber sehr wahrscheinlich.“
Und Relevanz?
Regelt der Markt.
4.5 Heimweg und Auftrag
Ein Eis schleckend bin ich – vorbei am gefüllten Markt, begleitet von Live-Musik auf großer Bühne – nach Hause gegangen.
Durch die ganze Karli, flankiert von Straßenrestaurants und ihrer „Kultur-Kneipen-Kultur“.
Zuhause angekommen, gab es für mich nur noch ein Medium:
ein Buch – digital.
Und eine Aufgabe, dringlich auf meinem Arbeitszettel:
eBook generieren.
Wie halten Sie das?
Andersen Storm
Keinen Beitrag mehr verpassen?