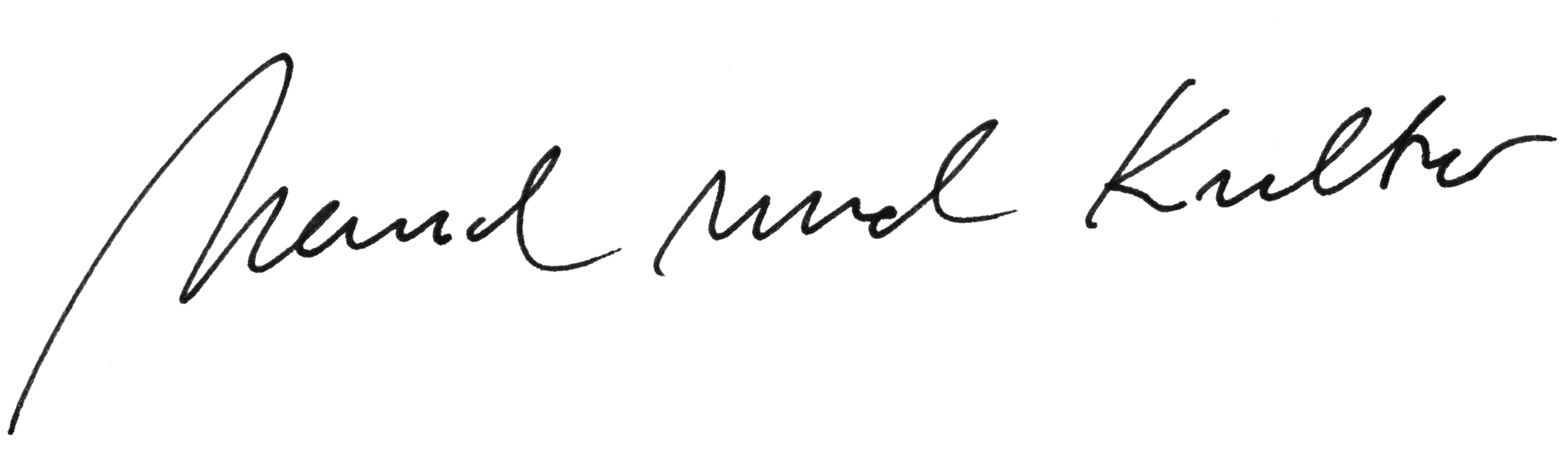Über Autorenschaft in Zeiten digitaler Assistenz
© 2025 Andersen Storm
Schreiben als geistiger Akt
Die Behauptung, nur wer seine Worte eigenhändig auf Papier bringt, könne als Autor gelten, hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Schreiben ist kein Handwerk allein, sondern in erster Linie ein geistiger Akt: das Ordnen, Formen und Verdichten von Gedanken zu Sprache. Die Hand, die den Stift führt, ist nur ein Werkzeug – ebenso wie heute Tastatur, Mikrofon oder Assistenzsystem.
Historische Praxis: Diktieren und Verschriften
Ein Blick in die Antike macht das deutlich. Cicero, Seneca oder Thomas von Aquin diktierten ganze Werke. Schreiber setzten ihre Worte nieder, Kommentatoren ergänzten, Kopisten verbreiteten die Texte. Am Ende blieb die Autorschaft unbestritten beim Denker, nicht beim Schreiber. Der Schreiber war Werkzeug, nicht Urheber. Auch Goethe ließ oft verschriftlichen; niemand käme auf die Idee, seine Werke den Schreibern zuzuschreiben.
Moderne Engführung der Autorschaft
Heute scheint das vergessen. Wer diktiert, wem andere beim Verschriften helfen, wer technische Hilfsmittel nutzt, sieht sich schnell mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht „wirklich“ zu schreiben. Dabei unterscheidet sich die Situation kaum von früher. Neu ist allein die verengte Vorstellung, dass nur derjenige Autor sei, der den gesamten Schreibprozess körperlich selbst vollzieht. Diese Vorstellung entspringt einer Moderne, die das Bild des einsamen Genies kultiviert hat – und einem Urheberrecht, das die Spur eines Werks auf eine einzelne Person fixieren will.
Ausdruck und Verantwortung
Doch Schreiben ist mehr als die motorische Bewegung der Hand. Sprache entfaltet ihre Wirkung schon im Moment des Ausdrucks: in der Rede, im Gedanken, in der poetischen Formulierung. Das Aufschreiben ist nur die Manifestation, nicht die Autorschaft selbst. Wer Gedanken in Worte fasst, ordnet und verantwortet, schreibt – auch wenn andere die Spur ziehen.
Diagnose: Eine begrenzte Sichtweise
Die Reduktion auf das „eigenhändige Niederschreiben“ verrät eine begrenzte Sichtweise auf die Welt. Sie verkennt die Vielfalt historischer Praktiken, die Möglichkeiten technischer Hilfsmittel und die Tatsache, dass der Gedanke in der Sprache immer größer ist als das Handwerk, das ihn zu Papier bringt.
Autorenschaft gründet nicht in der Einheit von Kopf und Hand in Personalunion, sondern in inhaltlicher Urheberschaft und Verantwortung.
Über den Autor
Andersen Storm ist Kulturautor, Podcaster und Musiker. Er arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Journalismus, Literatur und Bühne. Seine Texte verbinden essayistische Schärfe mit künstlerischer Praxis. Durch diese Erfahrung spricht er aus eigener Autorenschaft – unabhängig davon, ob Worte diktiert, verschriftlicht oder performt werden.
Möchten Sie das Thema vertiefen – im Gespräch oder in einer Keynote?