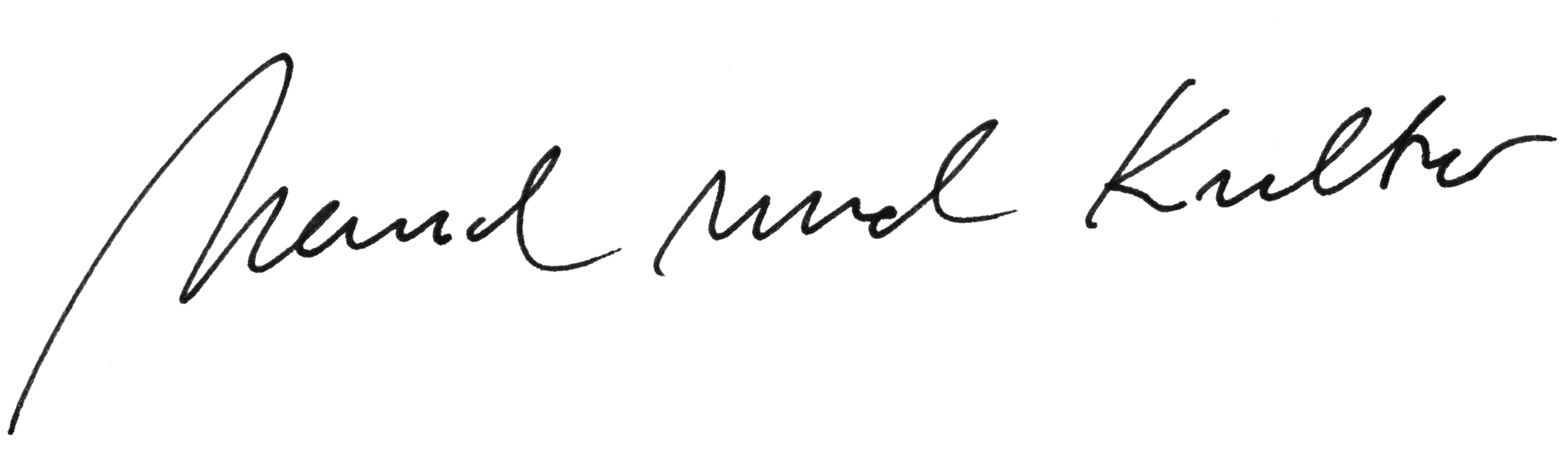Pop-Kultur „Buch“ und der drohende Bedeutungsverlust der Literatur
In Heft 910 des Merkur (März 2025) hat Gerhard Lauer in seinem Essay „Die neue literarische Öffentlichkeit – Zum Stand eines Strukturwandels“ eindrucksvoll gezeigt, wie sich die Buchkultur immer weiter von ihren klassischen Strukturen entfernt: BookTok, Farbschnitt-Editionen und eine Ästhetisierung des Buches als Lifestyle-Objekt dominieren inzwischen über inhaltliche Tiefe und kuratorische Verantwortung. Lauer beschreibt darin eine literarische Öffentlichkeit, die sich von traditionellen Institutionen abkoppelt und neue, teils unübersichtliche Formen der Teilhabe entwickelt.
Dieser Befund hat nicht nur im Kulturbetrieb selbst für Diskussionen gesorgt. So reagierte FAZ-Feuilletonredakteur Jan Wiele mit einer scharfen Kritik, in der er Lauers Analyse als Angriff auf die Legitimität literarischer Expertise las und vor dem Bedeutungsverlust professioneller Kritik warnte. Der Konflikt zeigt, wie zentral die Frage nach Symbolen, ihrer Aufladung und Entleerung heute für die Literatur geworden ist.
Mein Essay zur „Bedeutungsindustrie Buch“ nimmt diese Debatte auf: Ich untersuche den Kreislauf der Bedeutungsindustrien im Buchmarkt, frage nach der Rolle der Buchbranche zwischen Hyperrealität und Kuratierung : Symbol oder Substanz? – und argumentiere, dass die Literatur ohne eine neue Verbindung von Symbol und Substanz ihre gesellschaftliche Relevanz zu verlieren droht.
1. Vom Träger geistiger Reflexion zur ästhetisierten Oberfläche
Jede Bedeutungsindustrie muss zugreifen, um zu überleben – und entleert sich dabei ihrer eigenen inhaltlichen Bedeutung. Bücher, einst als Träger von Geschichten, Ideen und gesellschaftlicher Reflexion geschätzt, werden heute zunehmend zu Oberflächen, auf denen sich symbolische Zugehörigkeiten inszenieren lassen. Die neue Bookishness-Kultur, in der Farbschnittausgaben, BookTok-Videos und Buddy Reads dominieren, ist dafür das treffendste Beispiel: Nicht der Text steht im Mittelpunkt, sondern seine ästhetisierte Zirkulation.
2. Hyperrealität und Distinktion in der digitalen Buchkultur
Jean Baudrillard hat diesen Prozess als den Übergang von Symbolen zur Hyperrealität beschrieben: Sobald Zeichen nicht mehr auf etwas außerhalb ihrer selbst verweisen, sondern sich in unendlichen Schleifen gegenseitig bestätigen, entsteht eine Scheinwelt, die keine Substanz mehr benötigt. Das Buch wird in diesem Modus zum Simulacrum: als Lifestyle-Objekt, Statussymbol oder dekoratives Element in digitalen Aufmerksamkeitsökonomien. Die Hyperrealität der Bookishness lebt nicht vom Inhalt des Buchs, sondern von der Sichtbarkeit des Symbols „Buch“ im digitalen Raum.
Gleichzeitig greift Pierre Bourdieus Analyse der kulturellen Distinktion: Wo einst literarische Kompetenz und ästhetische Urteilskraft als Quellen kulturellen Kapitals galten, genügt heute oft die performative Zurschaustellung der eigenen Bücherliebe, um sich sozial zu verorten. Die Aneignung des Buchsymbols erzeugt Zugehörigkeit zu einer Community; sie verschafft kulturelles Kapital – jedoch weitgehend entkoppelt vom Textverständnis oder einer vertieften Auseinandersetzung. Distinktion entsteht nicht mehr durch Reflexion, sondern durch Inszenierung.
3. Aneignung, Kommerzialisierung, Entfremdung
Dieser Kreislauf aus Aneignung, Kommerzialisierung und Entleerung prägt nicht nur den Literaturbetrieb. Er spiegelt einen breiteren Trend der Popkultur, in dem Bedeutung zur Handelsware wird und Symbole in der Dauerschleife medialer Verwertung ihre Tiefe verlieren. Doch während Popmusik oder Mode sich schon lange in dieser Dynamik bewegen, war die Literatur traditionell ein Bereich, in dem Substanz Vorrang vor Symbol hatte. Diese historische Sonderstellung scheint sich nun aufzulösen.
Dabei hat sich die Buchbranche heute so weit von der schreibend-reflektierenden Praxis entfernt wie nie zuvor. Sie agiert nicht als Akteur kultureller Bedeutungsproduktion, sondern stellt sich auf ihren eigenen Bedeutungsverlust in einer KI-dominierten Digitalökonomie ein. Anstatt das Buch als Symbol durch kuratierte Diskurse und neue Bedeutungszusammenhänge wieder aufzuladen, fixiert sie sich auf kurzfristige Konsumimpulse: limitierte Auflagen, inszenierte Influencer-Lesungen, Farbschnitt-Editionen, die auf Social Media im Sekundentakt viral gehen. Der strategische Fokus liegt auf der effizienten Distribution von Oberflächenreizen, nicht auf der Schaffung neuer Kontexte für literarische Substanz.
4. Simulation statt Substanz: Vom Kulturmedium zur Unterhaltungsware
Symbole wie das Buch, die einst Bildung, Reflexion oder gesellschaftliche Teilhabe repräsentierten, werden nicht mehr bewusst gepflegt, sondern im Modus der permanenten Vermarktung erschöpft. Sie durchlaufen, was man mit Baudrillard als „Simulation“ einer kulturellen Tiefe beschreiben könnte: Die Form bleibt, doch der Inhalt verliert seine Verankerung in realer Reflexion. Diese Diagnose lässt sich jedoch nicht als bloße Nostalgie abtun, denn sie verweist auf einen grundsätzlichen Wandel der Buchbranche von einem kulturtragenden Akteur hin zu einer reinen Unterhaltungsindustrie.
Der Kern des Problems liegt dabei nicht in der Demokratisierung literarischer Öffentlichkeiten oder in der Existenz populärer Genres, sondern in der Aufgabe jeglicher kuratorischer Verantwortung. Indem Verlage und Buchhandlungen ihre Rolle als Instanzen der Bedeutungsvermittlung preisgeben, überlassen sie die Bedeutungsproduktion vollständig Plattformen und Algorithmen. Dieses Vakuum kann keine Farbschnitt-Sonderedition und kein virales Video füllen.
5. Das Buch als Resonanzraum – und warum es das wieder sein muss
Denn ohne die Geschichten, Gedanken und Perspektiven, die Bücher einzigartig machen, bleibt auch das Symbol „Buch“ letztlich hohl. Die Herausforderung liegt darin, den Kreislauf der Entleerung zu unterbrechen: kulturelle Aneignung nicht nur als Styling, sondern als Anlass zur Reflexion zu verstehen; Symbole nicht bloß zu konsumieren, sondern sie mit Bedeutung zu füllen. Es braucht eine neue Kuratierung, die nicht den Blick auf kurzfristige Absatzchancen verengt, sondern das Buch erneut als Resonanzraum etabliert – als Medium, das über die flüchtige Ästhetik hinausgehende Gespräche ermöglicht.
Nur eine solche Wiederaufladung des Symbols „Buch“ kann verhindern, dass die Literatur endgültig in der endlosen Schleife der Bedeutungsindustrien verschwindet.
Markkleeberg, 20250707
Lesen Sie hier Gerhard Lauers Essay „Die neue literarische Öffentlichkeit“ im Merkur:
merkur-zeitschrift.de/artikel/die-neue-literarische-oeffentlichkeit-a-mr-79-3-26/
und meinen Beitrag „Das Buch als Entlastungsartikel – Kultur im Kanal“ hier im Blog
Keinen Beitrag mehr verpassen?