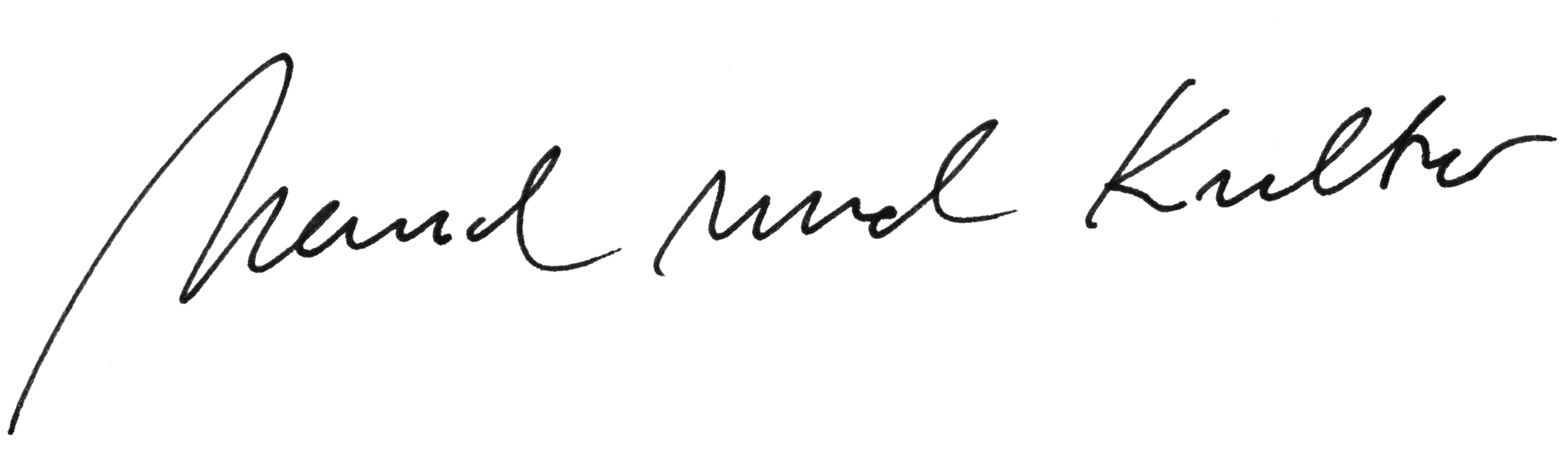Manchmal suche ich im Duden nach Wörtern, die für mich selbstverständlich sind – und finde sie dort nicht mehr. Wörter, mit denen ich aufgewachsen bin, tauchen im aktuellen Wörterbuch gar nicht auf. Da staunt der Laie – und der Fachmann wundert sich. „Was ist denn nun falsch an Autorenschaft?“ Die elektronisch-gestützte Rechtschreibkontroll-Instanz malt eine Wellenlinie darunter und sagt: „Das Wort ist veraltet und aus dem aktuellen Sprachgebrauch entfernt.“
Dann wird spürbar: Meine eigene Sprachpraxis gilt also offiziell nicht mehr. Kein: „Veraltet auch …“. Ich kann keinen Eintrag zu Autorenschaft im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG) finden. (Quelle: https://www.dwds.de/wb/wdg/search?q=Autorenschaft)
Wenn Wörter verschwinden, verschwindet mehr als Sprache
Diese Erfahrung zeigt sich nicht nur an einzelnen Begriffen. Sie verweist auf ein größeres Muster, das nach 1990 wirksam wurde.
Nach 1990 wurden ostdeutsche Sprachformen kaum tradiert und selten als gleichwertige Varietät des Deutschen behandelt. Wörterbücher, Institutionen und Verlage der DDR verschwanden; westdeutsche Normen setzten sich als gesamtdeutscher Standard widerstandslos durch. Dadurch gingen viele DDR-spezifische Ausdrücke tatsächlich aus dem öffentlichen Sprachgebrauch verloren. In Medien, Politik, Verwaltung oder Schule tauchen sie nun nicht mehr auf. Ein westdeutsch geprägter Sprachstandard dominiert – und ostdeutsche Begriffe erscheinen höchstens in nostalgischen oder ironischen Kontexten.
Westdeutsch standardisiert – ostdeutsch marginalisiert
Folge: Wer diese Wörter weiterverwendet, läuft Gefahr, „ostig“, altmodisch oder unverständlich zu wirken. Sprache wird so zum Marker sozialer Herkunft – und gleichzeitig zur Quelle von Verunsicherung. Dort wo ein stolzer südwestdeutscher Politiker seine Heimatsprache selbstverständlich auch nach Berlin mitbringt, sind Mandy und Olaf schon lustig, weil sie „ostdeutsch“ sprechen. Und beide haben nur gesächselt, nicht tatsächlich Ostdeutsch geredet. (Nein, liebe Widersprechende, ihr würdet auch ablehnen, dass Bayern Westdeutsch sprechen.)
Das heißt selbstverständlich nicht, dass alle als „ostdeutsch“ gebrandmarkten Wörter niemand mehr gebraucht. Das gesprochene und das als Sprachnorm anerkannte Wort sind zwei unterschiedliche Wesen. Aber viele dieser Wörter, die wie andere regionale Wortschöpfungen eben auch ein Gefühl von Geborgenheit huckepack tragen, sind kaum noch sinnvoll zu benutzen.
Was als erinnerbar gilt – und wer das entscheidet
Wie man das Vokabular einer Diktatur aus dem Sprachgebrauch entfernt, hat Deutschland nach 1945 schon einmal gezeigt. Nach dem Faschismus wurden Begriffe, die untrennbar mit dem NS-Regime verbunden waren, konsequent aus der öffentlichen Sprache gedrängt. Dieses Wissen um sprachliche Ausmerzung ist bis heute präsent – im Osten wie im Westen.
Für viele Ostdeutsche bedeutet das dennoch, dass ihre alltägliche Sprachpraxis nachträglich entwertet erscheint – weil sie nicht mehr anerkannt wird. Dieser systemische Effekt führt dazu, dass ein Teil der kulturellen Eigenheiten und Erinnerungen an die sozialistische Lebenswelt sprachlich unsichtbar geworden ist. Und zwar schon, bevor die Sprache selbst mit den mit ihr Sozialisierten verschwindet.
An das „Büdchen anne Ecke“ darf man sich mit Gefühl erinnern – das gilt als authentisch. Der HO-Einkauf mit Dederon-Netz dagegen fällt unter Ostalgie. Als hätte es dort nichts gegeben, was sich ebenso eingeprägt hat: Gerüche, Routinen, Sprache. Was erinnerbar bleibt hängt davon ab, wofür noch ein Platz vorgesehen ist – und was still verschwinden soll.
Markkleeberg, 15.09.2025
Andersen Storm arbeite als Autor, Musiker und Kulturgestalter an der Durchlässigkeit zwischen Kunst, Journalismus und Gesellschaft.