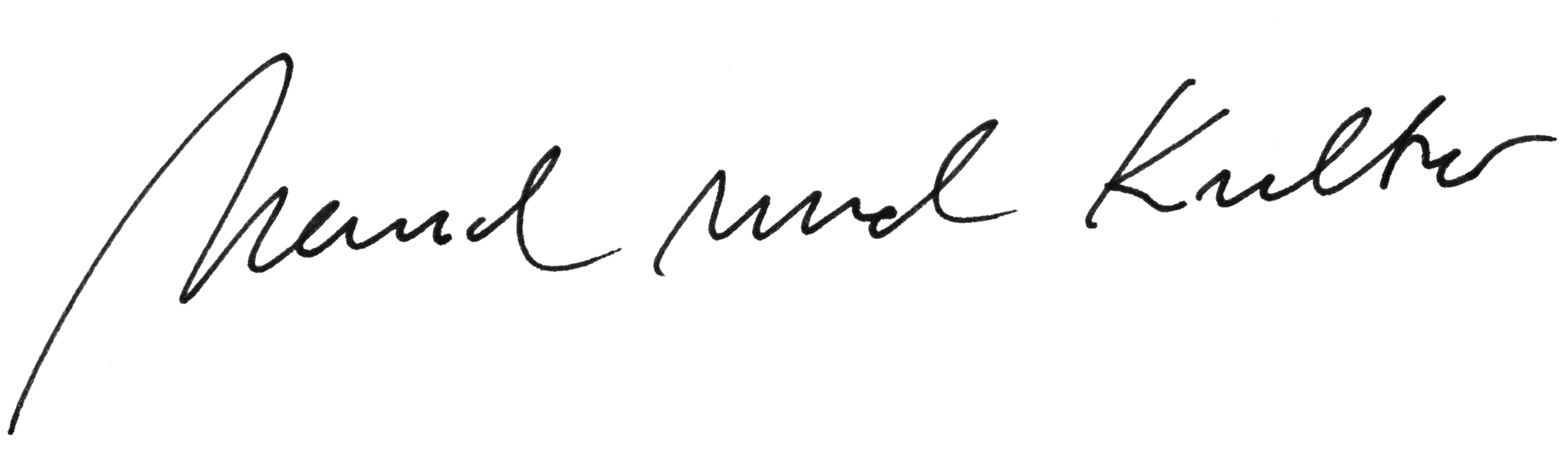Wie wir den Verlust politischer und gesellschaftlicher Sprache akzeptieren
Die Sprache unserer Zeit verändert sich. Im Business, in der Politik und auch im Alltag scheint die Sprache zunehmend in eine Profanisierung abzugleiten, die ihre ursprüngliche Macht als Werkzeug der Präzision und des Ausdrucks verblassen lässt. Was bleibt, ist ein sprachliches Flickwerk, das sich mal lässig, mal unverbindlich gibt – und immer darauf bedacht ist, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Doch was steckt dahinter, wenn ein B2B-Softwarehersteller statt „Kaufen Sie“ nun „Holen Sie sich“ sagt? Oder wenn Spitzenpolitiker nicht einmal mehr versuchen, ihre offensichtlichen Widersprüche rhetorisch zu kaschieren?
Die Sprache der Unverbindlichkeit
In der Geschäftswelt begegnet uns dieser Wandel zuerst subtil, dann dreist: Ein namhafter europäischer Waschmaschinenhersteller duzt seine Kunden in E-Mails nach dem Kauf – in einer Einbahnstraßenkommunikation, die Nähe suggeriert, aber keinen echten Dialog erlaubt. Kunden, die teure Geräte kaufen und den Profit des Unternehmens sichern, werden in ihrer Individualität und Bedeutung auf einen Klick reduziert. Die Strategie dahinter? Eine Mischung aus vermeintlicher Zugänglichkeit und knallharter Effizienz. Denn was wie ein freundlicher Tonfall erscheint, ist nichts anderes als die Entwertung einer Beziehung, die einst Respekt und Ernsthaftigkeit erforderte.
Im B2B-Bereich wird es noch grotesker:
Softwareabonnements werden mit Formulierungen wie „Holen Sie sich“ beworben, als ginge es um Gratisproben im Supermarkt. Diese Vereinfachung zeigt: Auch dort, wo Professionalität und Seriosität erwartet werden, triumphieren mittlerweile Marketingsprache und Konsumdenken über Inhalt und Substanz.
Politik: Von Flexibilität bis zum Gesichtsverlust
Die sprachliche Verwässerung, die wir in der Wirtschaft beobachten, macht auch vor der Politik nicht halt. Wenn sich diese Entwicklungen ins Politische übertragen, wird der Schaden ungleich größer. Spitzenpolitiker operieren heute in einem Umfeld, in dem offensichtlich widersprüchliche Aussagen oder Lügen keine ernsthaften Konsequenzen mehr haben. Eine Aussage wie „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“ wäre heute wieder als Beweis der Wahrnehmung der eigenen Kommunikationsdefizite bemerkenswert.
Warum tolerieren wir das? Weil das Wahlvolk angesichts fehlender Alternativen gezwungen ist, diese Beliebigkeit hinzunehmen. Man wählt das geringere Übel und akzeptiert dabei eine Politik, die weniger von Überzeugungen und langfristigen Strategien geprägt ist als von kurzfristiger Anpassung an die Dynamik von Medien, Krisen und Meinungsumfragen. Politiker handeln wie rollende Steine auf einer abgehenden Lawine: Sie passen sich an, um weiter nach oben zu kommen, und drehen sich dabei in jede Richtung, die nach oben führen könnte.
Die Konsequenzen des sprachlichen Erosionsprozesses
Diese sprachliche und inhaltliche Beliebigkeit hat weitreichende Folgen. In der Politik führt sie zu einem massiven Vertrauensverlust. Bürger wenden sich ab, weil sie das Gefühl haben, dass Worte nichts mehr bedeuten – und genau darin liegt die Gefahr. Denn Sprache ist nicht nur ein Werkzeug der Kommunikation, sondern auch der Ordnung und Orientierung. Wo sie verwässert wird, verlieren wir die Möglichkeit, uns zu positionieren und zu handeln.
Im Business resultiert dieser Wandel in einer Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden, die auf Effizienz reduziert ist. Der Kunde, einst „König“, ist heute nur noch ein Klick in der Masse, eine Zahl im Jahresbericht. Sein Beitrag zur Dividende wird zur „Hol“-Leistung umdefiniert. Kunden gewähren keine Gunst mehr, sie erfüllen die Kaufaufgabe.
Was bleibt?
Diese Entwicklungen sind keine Naturgesetze. Sie sind Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels, der Sprache zu einem bloßen Mittel degradiert. Diese sprachliche Entwicklung spiegelt sich insbesondere in postmodernen Gesellschaften wider, in denen pragmatische Anpassung häufig ideelle Werte verdrängt. Doch es liegt an uns, diese Tendenzen zu hinterfragen. Wir können bewusst Unternehmen wählen, die Respekt in ihrer Kommunikation zeigen, und Politiker, die nicht nur flexibel, sondern auch prinzipientreu sind.
Wir können Sprache wieder als das begreifen, was sie ist: ein Werkzeug der Verantwortung, nicht der Beliebigkeit. Sie bleibt dabei entscheidend für die Orientierung und den Zusammenhalt in unserer modernen Gesellschaft, in der Sprache als verbindendes Element unverzichtbar ist.
Ich lade Sie ein, Ihre Meinung zu diesem Thema zu teilen: Kommentieren Sie und diskutieren Sie mit! Abonnieren Sie meinen Newsletter, um keine weiteren Kolumnen zu verpassen.
Wenn Sie Interesse daran haben, diese oder andere meiner Kolumnen in Ihrem Print- oder Onlinemedium zu veröffentlichen, kontaktieren Sie mich gerne direkt.
Keinen Beitrag mehr verpassen?