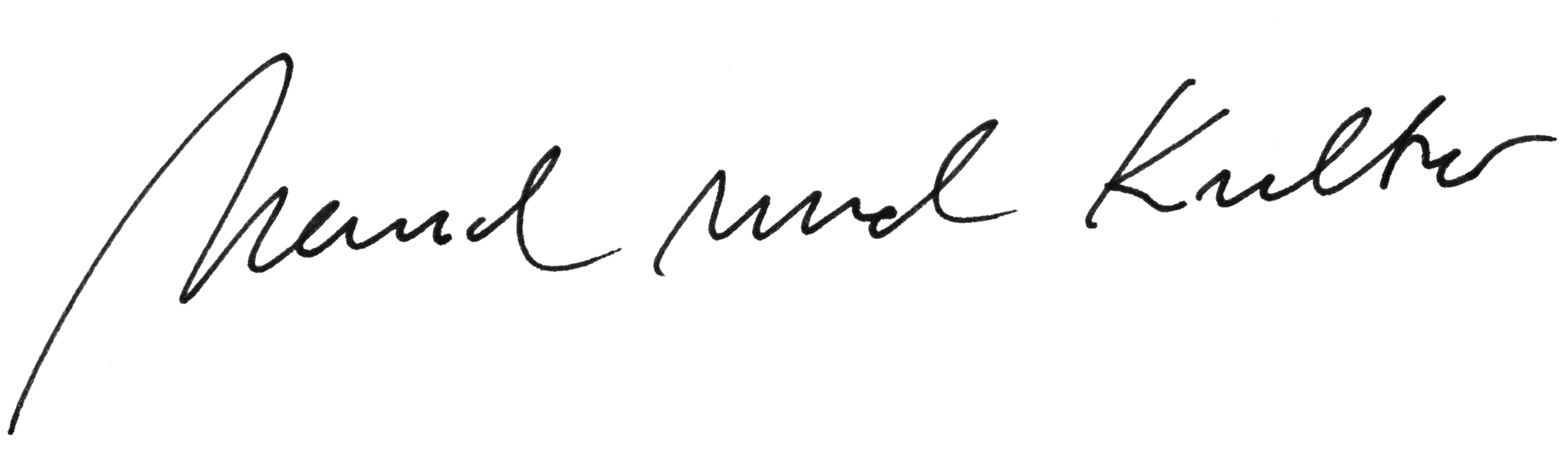Vorweg: Ein Entwurf – und die Frage, woran wir ihn messen.
Während in Deutschland heute der Entwurf eines Koalitionsvertrags zwischen CDU/CSU und SPD vorgestellt wird, verschiebt sich global das Koordinatensystem demokratischer Politik: Die Rückkehr Donald Trumps steht exemplarisch für eine autoritäre Neuordnung, die nicht auf Kompromisse, sondern auf Unübersetzbarkeit zielt. Europa droht, in diesem Umbruch bloß reaktiv zu bleiben – statt eigene politische Maßstäbe zu setzen.
Dieser Text analysiert die Risiken einer Demokratie-Erosion im Gewand westlicher Rhetorik, benennt die strategischen Chancen für ein eigenständiges europäisches Modell – und formuliert fünf konkrete Empfehlungen, an denen sich auch der neue Koalitionsentwurf messen lassen muss.
Europa steht an einer Wegscheide. Die Frage ist nicht mehr, ob sich unser Kontinent in einem neuen geopolitischen und kulturellen Kräftefeld positionieren muss, sondern wie bewusst und wie strategisch er dies tut. Die Rückkehr Donald Trumps in das Zentrum politischer Macht markiert keine Umkehr, sondern die Vollendung eines Wandels: weg von demokratischer Repräsentation hin zu einem autoritär-patronalistischen Staatsverständnis, das nicht auf Konfliktaustragung, sondern auf strukturelle Zersetzung zielt.
Trumps Politik ist dabei nicht originell – sie ist ein Katalysator. Sie greift auf ein uraltes Prinzip zurück: Zerteile und herrsche. Doch in seiner heutigen Umsetzung geht es nicht mehr um die Führung konkurrierender Milieus, sondern um die Zerstörung gesellschaftlicher Übersetzbarkeit selbst. Die Strategie ist kein konservativer Kulturkampf, sondern ein Angriff auf die Vorstellung gemeinsamer politischer Wirklichkeit. Wenn es keine verbindlichen Begriffe mehr gibt, keine geteilten Normen, keine geteilte Sprache für Konflikte und Verantwortung, dann wird jede Form politischer Organisation jenseits bloßer Machtmobilisierung sinnlos.
Diese Strategie ist bereits sichtbar:
– in der Zerschlagung institutioneller Kontinuitäten, etwa durch Misstrauen gegenüber Justiz, Wissenschaft und Medien;
– in der Kultivierung permanenter Ungewissheit durch widersprüchliche Aussagen, gezielte Desinformation und Personalinstabilität;
– in der Schaffung antagonistisch aufgeladener Milieus, die sich nicht mehr verständigen, sondern nur noch mobilisieren lassen.
Nach außen wird diese Logik fortgeführt: Kooperation wird durch kurzfristigen Tauschwert ersetzt, Souveränität nur noch als Zugang zu Märkten, Daten oder strategischer Infrastruktur verstanden. Ideologische Plausibilitäten werden ersetzt durch identitätsbasierte Loyalitäten. Es genügt nicht mehr, zuzustimmen – man muss sich bekennen.
Diese Verschiebung betrifft auch Europa, wenn es ihr nicht bewusst entgegentritt. Die stille Gefahr liegt in der unreflektierten Übernahme einer entgrenzten politischen Logik, die Diskurse in Affekte und Institutionen in Showformate verwandelt. Wer auf diese Realität nur reagiert, statt sie strategisch zu adressieren, verliert nicht nur Anschlussfähigkeit, sondern seine demokratische Substanz.
Vor diesem Hintergrund wird der neue Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD in Deutschland zu einem Lackmustest: Bleibt er ein Verwaltungspapier für innerdeutsche Verteilungskonflikte – oder markiert er den politischen Willen, sich dieser tektonischen Verschiebung bewusst entgegenzustellen?
Deutschland, als ökonomisch und institutionell stabilstes Land der EU, trägt in diesem Prozess eine doppelte Verantwortung: nach innen, um demokratische Übersetzungsräume zu sichern, und nach außen, um Europa als eigenständiges politisches Modell zu behaupten. Es geht um mehr als Regierungsfähigkeit – es geht um die Wiederherstellung politischer Zukunftsfähigkeit.
Daraus ergeben sich fünf Empfehlungen, die nicht als Parteipositionen zu verstehen sind, sondern als Grundelemente einer demokratischen Resilienzstrategie für das 21. Jahrhundert:
1. Diskursräume verteidigen – Sprache als demokratische Infrastruktur anerkennen
Demokratische Politik beginnt nicht mit Wahlen, sondern mit der Fähigkeit, Wirklichkeit gemeinsam zu benennen. Wenn Begriffe zersplittern, erlischt die Möglichkeit politischer Organisation. Deutschland sollte gezielt in plural strukturierte Medien, Bildungseinrichtungen und Öffentlichkeiten investieren, die Diskurs ermöglichen statt ihn zu ersetzen.
2. Deliberative Beteiligung institutionalisieren – nicht nur repräsentativ regieren
Demokratische Resilienz entsteht dort, wo Menschen strukturiert mitgestalten können. Bürgerräte, digitale Beteiligungsformate und verbindliche Gemeinwohlbudgets müssen nicht Ausnahme, sondern Regel werden. Deutschland kann hier Vorbild sein – durch den Aufbau verbindlicher Beteiligungsformate mit legislativem Einfluss.
3. Sozialstaat als politische Grundlage verstehen – nicht als Kostenstelle
Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist keine Folge von Wirtschaftspolitik, sondern deren Voraussetzung. Wer soziale Teilhabe schwächt, öffnet autoritären Mobilisierungsstrategien den Raum. Sozialpolitik ist nicht karitativ, sondern infrastrukturell: Sie hält Gesellschaften übersetzbar und handlungsfähig.
4. Außenpolitik als Kulturpolitik begreifen – Verlässlichkeit vor Transaktion
Deutsche Außenpolitik muss europäische Souveränität nicht nur militärisch oder wirtschaftlich absichern, sondern kulturell. Es geht um Regelbindung, Partnerschaft und langfristige Strategiefähigkeit – nicht um kurzfristige Positionsgewinne. Europa braucht keine neuen Blöcke, sondern neue Beziehungen.
5. Den transatlantischen Bruch benennen – und eigenständige Alternativen aufbauen
Die Vorstellung eines ungebrochenen Wertebündnisses mit den USA ist spätestens seit der Normalisierung autoritärer Praktiken obsolet. Deutschland sollte den Mut haben, diesen Bruch zu benennen – und europäische Alternativen zu denken, die Kooperation nicht durch Angst, sondern durch gemeinsame Normen organisieren.
Diese fünf Punkte stehen nicht für einen Rückzug aus der Welt, sondern für ihre politische Wiedergewinnung. Sie setzen auf Demokratie als Fähigkeit zur Übersetzung – von Interessen, von Lebenslagen, von Konflikten. Nicht als Harmonisierung, sondern als Struktur der Gemeinsamkeit im Dissens. Nur wenn diese Struktur aktiv verteidigt und weiterentwickelt wird, hat Europa eine Zukunft, die über das bloße Überleben hinausreicht.
Andersen Storm, © 2025
Dieser Text kann als Kolumne, Feuilletonbeitrag oder Impuls veröffentlicht oder diskutiert werden.
Bei Interesse an Nachnutzung oder Kooperation melden Sie sich bitte über das Formular unten.
Keinen Beitrag mehr verpassen?